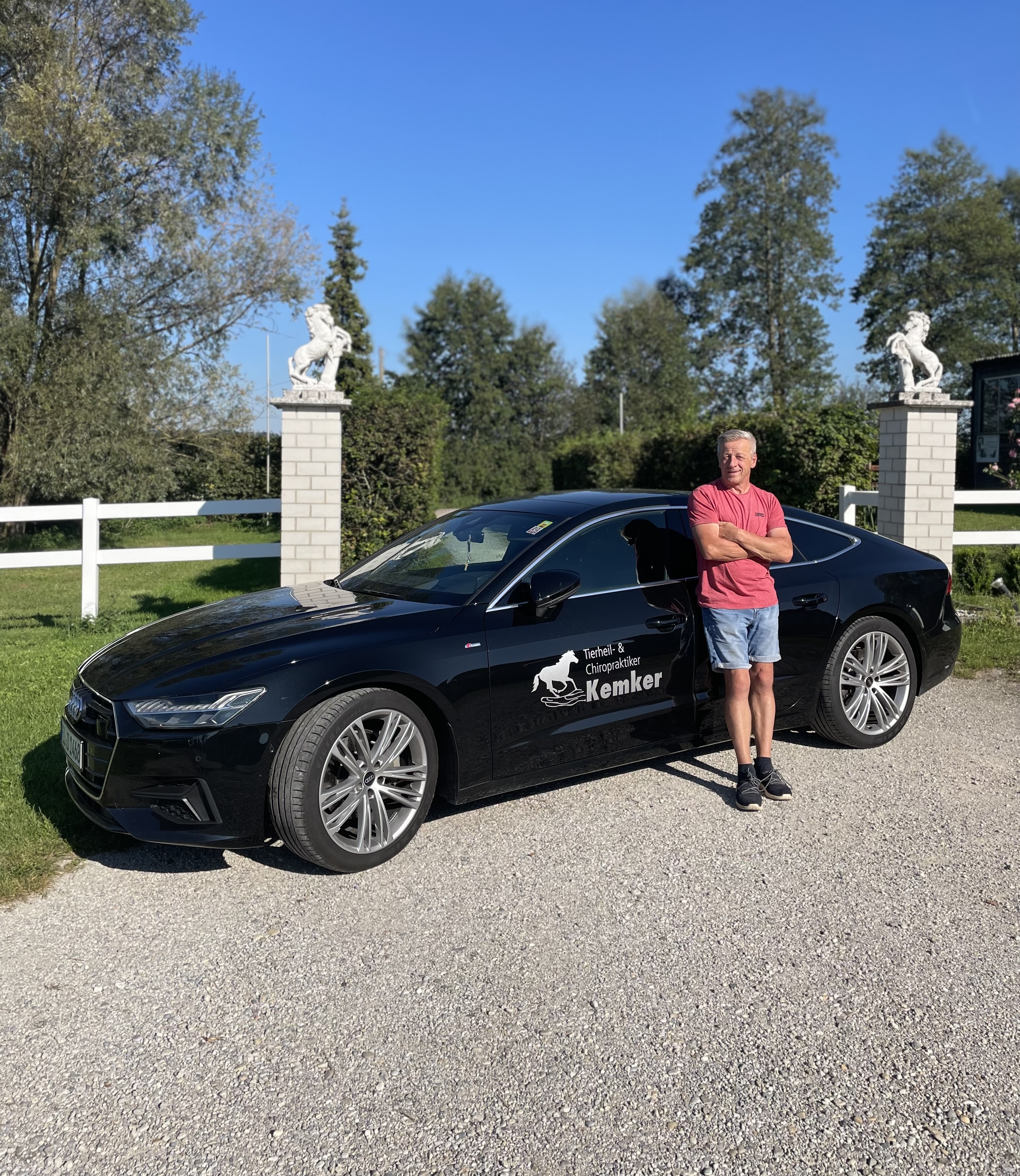
Über mich
Mein Name ist Dieter Kemker und ich komme aus Neulehe (Emsland). Die Liebe zum Tier loderte schon immer in mir. Als Kind gab es für mich nichts Schöneres, als ohne Sattel und nur mit Strick und Halfter auf den Wiesen zu galoppieren, auch wenn die Ponys oft den Weg einschlugen, den sie für richtig hielten. Natürlich besaß ich immer wieder auch ein oder mehrere eigene Pferde. Die Vogelwelt hat es mir ebenfalls angetan, sodass auf meinem Grundstück nach und nach eine Vogelzucht entstand.

Das sagen meine Kunden
Der Herr Kemker besucht uns nun schon längere Zeit regelmäßig am Hof und behandelt hier Pferde, Katzen, Hunde und das mit wirklich großem Erfolg. Gerade unserem alten Hund, der mittlerweile 16 ist und schon einige Zipperlein hat, verschafft Herr Kemker immer wieder eine neue Lebensqualität. Wir hoffen, Sie bleiben uns und den Tieren noch ganz lange erhalten. Alles erdenklich Gute für die Zukunft.
Sandra A. aus Pappenheim
Sehr geehrter Herr Kemker,
ich wollte mich bei Ihnen für die tolle Behandlung an meinem Bosniaken Chicco bedanken. Chicco hatte Schulet- und Rückenprobleme. Leider konnte ich bei der Behandlung selbst nicht dabei sein, aber ich erhielt einen ausführlich positiven Bericht.
Das war definitiv nicht der letzte Besuch. Absolute Empfehlung!
Martina I. aus Mannweiler-Cölln
Behandlungen

Einrenken des Kreuzdarmbeins

Atlaskorrektur

Brustwirbelblockaden lösen

Behandlung des Ischias
Kontakt aufnehmen
Zögern Sie nicht, sich mit den unten stehenden Kontaktinformationen zu melden oder eine Nachricht über das Formular zu senden.






